05.10.2025
Kessler: „Zu viel Kontrolle ist häufig religiöser Machtmissbrauch“
Ein idea-Interview mit Dr. Martina Kessler
Immer wieder stehen Gemeinden wegen Vorwürfen von religiösem Missbrauch in der Kritik. Wie können Christen unterscheiden zwischen gesunder Leitung und zerstörerischem Druck?
IDEA-Leiterin Daniela Städter sprach mit Dr. Martina Kessler

Dr. Martina Kessler
© privat
(idea) Martina Kessler (64) ist promovierte Theologin und psychologische Beraterin. Hauptberuflich arbeitet sie für die Akademie für christliche Führungskräfte sowie die Stiftung Therapeutische Seelsorge. Ehrenamtlich leitet sie den Arbeitskreis „Religiöser Machtmissbrauch“ der Evangelischen Allianz in Deutschland (EAD) und ist Mitherausgeberin des EAD-„Leitfadens zum Umgang mit religiösem Machtmissbrauch“.
IDEA: Ist religiöser Machtmissbrauch ein Randphänomen in exotischen Sekten oder ein Problem in unseren Gemeinden?
Kessler: Es kommt leider häufiger vor, als man das möglicherweise vermutet. Religiöser Missbrauch ist auch in normalen christlichen Kreisen zu Hause. Aber ich warne gleichzeitig davor, jede Gemeinde unter Generalverdacht zu stellen.
Sie legen Wert darauf, von Religiösem Missbrauch zu sprechen und nicht von geistlichem Missbrauch. Warum?
„Geistlicher“ Missbrauch erinnert ganz schnell auch an den Heiligen Geist. Es ist immer Religion, die missbraucht – und nicht der Geist Gottes. Im katholischen Umfeld spricht man übrigens von spirituellem Missbrauch. Damit könnte ich auch leben.
In manchen Theologisch-konservativen Gemeinden gibt es klare ethische Vorgaben. Sex außerhalb und vor der Ehe gilt als Sünde, gelebte Homosexualität ebenfalls. Vor der Hochzeit zusammenzuziehen ist tabu. Wer das ablehnt, dem droht möglicherweise der Ausschluss. Wo verläuft die Grenze zwischen gesunder Lehre und missbräuchlichem Druck?
Eine entscheidende Linie ist: Habe ich es mit gesunden Erwachsenen zu tun? Traumatisierte Menschen sind so verletzt, dass andere Voraussetzungen gelten. Wer aber als gesunder Erwachsener eine Gemeinde wählt, deren Regeln klar kommuniziert sind, übernimmt dafür auch Verantwortung – ähnlich wie in Orden oder Kommunitäten. Ändert jemand später seine Meinung, kann man das besprechen, aber es ist nicht das Problem der Gemeinde. Hier von religiösem Machtmissbrauch zu sprechen wäre unfair. Problematisch ist eher, dass Gemeinden solche Fragen oft nicht vorbeugend, sondern erst dann diskutieren, wenn der erste Konflikt auftritt.
Was ist darüber hinaus wichtig?
Wichtig ist zudem die Unterscheidung zwischen erstrangigen und zweitrangigen Fragen: Im Zentrum stehen das Bekenntnis zu Jesus Christus, Kreuz und Auferstehung. Sexualethische Fragen müssen in Gemeinden geklärt werden, sind aber zweitrangig. Wenn Gemeinden das klar trennen, sinkt auch das Risiko von religiösem Missbrauch. Leider werden Lieblosigkeit, Steuerhinterziehung, verbale Gewalt usw. hingenommen. Das müssten wir aber, wenn wir biblisch unterwegs wären, genauso zum Thema machen wie sexualethische Fragen.
Welche weiteren Themen begegnen Ihnen beim Thema religiöser Machtmissbrauch?
Neokonservatismus, Entlassungen – auch aus dem Ehrenamt –, Überhöhung von Leitung, gepaart mit autoritären Leitungsstilen – um nur einige zu nennen.
Gemeindetraditionen und -stile sind nun mal unterschiedlich. Was für die einen Machtmissbrauch ist, ist für die anderen ein kulturell und religiös begründetes ehrenhaftes Verhalten. Wo sind die Grenzen?
Wir müssen bei anderen Hintergründen tatsächlich vorsichtig sein und dürfen nicht unseren deutschen Maßstab weltweit anlegen. Aber es gibt absolute Grenzen. Wo Menschen durch religiöse Begründungen in Unfreiheit, Angst oder Abhängigkeit gedrängt werden, beginnt Machtmissbrauch. Der Geist Gottes will in jeder Kultur in die Freiheit führen. Dabei müssen wir aber berücksichtigen, dass etwa in Scham-Ehre-Kulturen Schuld und Verantwortung anders verstanden werden als bei uns. Ich muss Lösungen innerhalb der Kultur suchen.
Scham-Ehre-Kulturen?
Ein Beispiel: Als die EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann wegen einer Alkoholfahrt zurücktrat, war ich gerade in Südafrika. Unsere theologischen Kollegen dort sagten uns: „Bei uns hätte der Polizist seinen Job verloren, der sie angehalten hat – und nicht die Bischöfin.“ Das ist das Schuldverständnis dort. Weil Frau Käßmann aus ihrer Sicht eine wichtige Frau ist, darf sie daher öffentlich nicht beschämt werden. Wenn wir einfach unsere Kriterien auf andere Kulturen übertragen, führt das unter Umständen zu Irritationen.
Manche Gemeinden nennen es Sünde, weltliche Romane zu lesen oder Filme wie Harry Potter zu schauen. Mitglieder werden angehalten, auch ihre Freizeit komplett in der Gemeinde zu verbringen. Ist das noch gelebte Frömmigkeit oder Kontrolle?
Jesus sagte: „Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium“ (Markus 16,15). Da finde ich es falsch, die Schotten dicht zu machen. Erwachsene werden mit solchen Grundsätzen bevormundet, und das zeigt eher schwache Leitung. Starke Leitung hält es aus, wenn Menschen Dinge tun, die sie nicht gut findet, und redet darüber. Oft steckt dahinter die Angst, dass weltliche Dinge zu Zweifeln oder Fragen führen könnten.
Ist das nun religiöser Machtmissbrauch oder zu viel Kontrolle?
Zu viel Kontrolle ist häufig religiöser Machtmissbrauch – besonders wenn mit Bibelversen Angst gemacht wird. Empfehlungen sind möglich, aber es gibt Grenzen. Neulich erzählte mir ein Mann Folgendes: Er war geschieden und wollte eine Single-Frau heiraten. Ihr
sagte man in ihrer Gemeinde: „Wenn du einen geschiedenen Mann heiratest, kommst du nicht in den Himmel.“ Wo steht das so in der Bibel?
Immer wieder stehen Gemeinden in der Kritik, zuletzt u. a. die charismatische „Freie Christliche Jugendgemeinschaft“ (FCJG) in Lüdenscheid. Mitglieder und Mitarbeiter in der Gemeinschaft seien manipuliert und gedemütigt worden. Im Zentrum steht der langjährige Hauptleiter und jetzige Präsident der FCJG, Walter Heidenreich. Eine Frau schildert gegenüber den „Lüdenscheider Nachrichten“, Heidenreich habe verkündet, Gott habe ihm gezeigt, dass Sünde in der Gemeinschaft sei. Dann sei einer nach dem anderen nach vorne getreten, habe sein Innerstes entblößt. Wer nicht mitmachte, sei beobachtet und unter Druck gesetzt worden, seine Fehlerhaftigkeit zu erkennen. Wie beurteilen Sie eine solche Szene?
Wenn er sagt, Gott habe ihm gezeigt, dass Sünde in der Gemeinschaft ist, dann muss das auch für ihn selbst gelten – wo Menschen sind, ist Sünde. Dass Leute nach vorne kommen mussten, sehe ich kritisch. Sünde soll bereinigt werden, aber zwischen mir und Jesus oder in der Seelsorge – und nicht durch öffentliche Demütigung. Hier ist eine enorme Gruppendynamik ausgelöst worden, und das hat keine biblische Grundlage.
Weiter sagt eine Frau über Heidenreich: „Er war, wie er selbst sagte, voll des Heiligen Geistes … frei von Sünde. Nur die anderen waren voller Stolz, voller Dämonen, voller Versagen. Und angeblich konnte er durch jeden Einzelnen hindurchsehen und erkennen, was in ihnen vorgeht.“
Zum ersten Satz sage ich: Walter Heidenreich, das ist Hochmut pur. Und das ist bekanntlich ja eine Sünde. Ohne Sünde zu sein, kann nur Jesus Christus von sich sagen. Wo Menschen sind, wird immer Sünde sein, auch wenn man in der Heiligung lebt. Dass er durch jeden Menschen hindurchgucken kann, ist eher eine Aussage, die Druck erzeugt, als dass da wirklich Substanz hinter ist. Das kann ja jeder behaupten. Ich habe da starke Zweifel, denn Gott arbeitet nicht so. Gott gibt mir Erkenntnis über mich und Ihnen Erkenntnis über Sie. In der Seelsorge erlebe ich es hier und da, dass Gott mir mal was mitteilt oder ich intuitiv reagiere und den Finger in die offene Wunde legen kann. Aber das sind wirklich besondere und deshalb heilige Momente. Das passiert nur gelegentlich.
Eine andere Person äußert: „Durch massiv hierarchische Leitungsstrukturen, an deren Spitze ausschließlich Walter Heidenreich steht, geht es primär um das religiöse Funktionieren, Geld und Erfolg. Menschen werden, salopp gesagt, wie Schachfiguren durch Manipulation hin und her versetzt.“
Dieses „Menschenschach“ habe ich anderswo auch erlebt – und das ist Manipulation, die mit dem Evangelium unvereinbar ist. Der Geist Gottes führt immer in die Freiheit, deshalb müssen Menschen geistlich mündig werden dürfen. Gerade in solchen Strukturen wie bei der FCJG sind viele verletzte Menschen zu Hause, etwa durch Drogenerfahrungen. Mit ihrer Verletzlichkeit dann so umzugehen ist schlicht gemein. Außerdem fehlt oft die Auseinandersetzung: Streiten und Ringen um Wahrheit ist biblisch und notwendig. Wenn Leitung Druck ausübt, ist das nicht tragbar.
Wie viel Kritik muss eine Leitung ertragen?
Es ist eine Gratwanderung: Dauerndes Nörgeln verurteilt die Bibel, aber Kritik grundsätzlich als ungeistlich abzuwehren ist ebenso problematisch. Wenn jemand chronisch nörgelt, sollte die Leitung fragen, wie man dieser Person helfen kann, statt ihr das Kritisieren einfach zu verbieten. Manchmal bleibt am Ende leider nur, sich von einer solchen Person so gütlich wie möglich zu trennen. Aber grundsätzlich muss Leitung Kritik aushalten können!
Der Vorwurf von Machtmissbrauch kann auch ein Mittel sein, selbst Macht auszuüben.
An den Reaktionen der Beschuldigten merkt man aber oft, ob ein Vorwurf berechtigt ist. Mich hat schon mal ein Beschuldigter ausgelacht und nur lapidar gesagt: „Ich doch nicht.“ Andere Täter machen sich zum Opfer und äußern so Sätze wie: „Die tun ja gerade so, als wären wir Monster.“ Andere wiederum gehen offen mit den Vorwürfen um und sind bereit, sich mit dem Vorwurf auseinanderzusetzen.
Welche Strukturen begünstigen religiösen Missbrauch?
Ich würde ungern Strukturen aufzählen, weil aus dem, was dann in der Liste möglicherweise fehlt, leicht falsche Schlüsse gezogen werden. Wichtiger ist die Frage: Was schützt Menschen? Entscheidend ist, ob Christen mündig werden dürfen und wie mit der Tugend des Gehorsams“ umgegangen wird. Erwachsenen einfach zu sagen: „du musst gehorsam sein“, ist problematisch – selbst bei der Bundeswehr gilt Gehorsam nicht absolut, es gibt Befehle, die ein Soldat nicht befolgen darf.
Das müssen Sie konkretisieren.
In einer Gemeinde wurde Gehorsam eingefordert, in welchen Hauskreis man zu gehen hat.
Wie bitte?
Gott hatte offensichtlich einen Hauskreisplan gemacht. So wurde es zumindest der Gemeinde gesagt. Jede Leitung hat natürlich das Recht, über eine Hauskreisstruktur nachzudenken. Wenn das eine Person aber begründet ablehnt, kann man ihr nicht sagen: „Dann bist du Gott ungehorsam.“ Da geht der religiöse Machtmissbrauch los. Leitung muss immer lernbereit bleiben. Eine fachliche und geistliche Begleitung tut jeder Gemeinde gut. Supervision ist leider bis heute kein Thema von Gemeindeleitung. Das ist schade. Richtig schade.
Viele landes- und freikirchliche Gemeinden sind in überörtliche Strukturen eingebunden, dadurch gibt es ein Korrektiv. Was ist mit frei schwebenden freikirchlichen Gemeinden?
Solche Gemeinden haben oft eine Top-down-Leitung. Ich würde mich einer solchen Gemeinde nicht anvertrauen, da die Gefahr von religiösem Machtmissbrauch groß ist. Häufig fehlen Transparenz und offene Kommunikation. Ein Beispiel: Eine Person brachte beim Lobpreis eine Idee ein, hörte nie wieder davon und wurde nach und nach isoliert. Statt klar zu sagen: „das wollen wir nicht“, wurde sie über Umwege ausgeschlossen. In extremen Fällen gilt ein Veränderungsvorschlag schon als Kritik an der Leitung.
Gibt es Gemeindeformen, wo das Risiko besonders hoch ist?
Das Risiko steigt meiner Erfahrung nach dort, wo Leitungspersonen überhöht werden und als unangreifbar gelten – etwa als „Gesalbte des Herrn“. Theologisch ist das unsauber, denn nach dem Neuen Testament sind alle Christen gesalbt. Wird der Leitung blind vertraut, entsteht eine ungute Mischung. Menschen müssen mündig werden dürfen. Das Neue Testament fordert, im Glauben erwachsen zu werden – kindlich sollen wir nur im Vertrauen auf Gott sein. Zudem ist nicht jede Bibelauslegung eines Menschen automatisch richtig. Die Bibel ist richtig, aber meine Auslegung kann falsch sein. Ich wünsche mir, mehr Menschen würden selbstkritischer an die Bibel rangehen. Dann wären sie auch diskussionswilliger.
Wie können Gemeinden Machtmissbrauch vorbeugen?
Gemeinden brauchen starke geistliche Leiter. Problematisch wird es, wenn ein Leiter sagt: „Ich habe Gott gefragt, er hat Folgendes gesagt, und deswegen machst du das jetzt so.“ Wenn ich andere Menschen leite, dann muss ich immer Gott und die Menschen fragen. Gesunde Leitung fördert verantwortungsvolle, selbstdenkende Menschen, die im Glauben wachsen dürfen – auch über die Leitung hinaus. Das ist die eigentliche Stärke von Leitungspersonen. Stärke heißt nicht, andere kleinzuhalten. Zugleich braucht es Menschen, die sich leiten lassen und dennoch in der Lage sind, in wohlwollend kritische Distanz zu gehen, um das System angemessen differenziert anschauen zu können. In dieser Balance wird Leitung geachtet. Der Theologe Heinrich Christian Rust hat das in einem Artikel so formuliert: „,Die da oben‘ lieben uns – und wir lieben sie.“
Was raten Sie Menschen, die religiösen Machtmissbrauch erlebt haben?
Ich schaue zuerst, wer sich an uns wendet: Sogenannte „Trauma-1-Personen“ haben noch Ressourcen und können Schritte gehen, um ihre Lage zu verändern. Oft ist es hilfreich, persönliche Fallen zu erkennen: Wer Macht missbraucht, nutzt nämlich nicht nur die Schwächen, sondern gerade die Stärken einer Person. Wer etwa Wahrhaftigkeit als Wert hochhält, lässt sich manipulieren, wenn man seine Wahrhaftigkeit infrage stellt – so kann jeder Wert gegen eine Person gewendet werden. Andere sind schon stark gebeugt ins System gegangen oder darin gebrochen. Ihnen fehlen Ressourcen, allein herauszukommen. Dann braucht es Therapie, die zunächst stützt und schützt, bevor Verletzungen bearbeitet werden. Das ist ein langer Weg mit sensiblen Phasen, bis wieder klar wird, was richtig und falsch ist und wem man vertrauen kann.
Vielen Dank für das Gespräch!
LEITFADEN ZUM UMGANG MIT RELIGIÖSEM MACHTMISSBRAUCH
Das Ampelsystem als Anwendungsbeispiel und Hilfestellung zur Selbsteinschätzung
4. überarbeitete Aufalge 2025
Dokument herunterladen
(pdf ǀ 2 MB)nicht gedruckt verfügbar
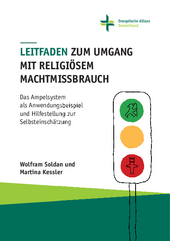
„... seid ein Vorbild für die Herde.“ (1. Petrus 5,3) - Prävention vor religiösem Machtmissbrauch
Anregungen für den Umgang innerhalb christlicher Gemeinschaften
Dokument herunterladen
(pdf ǀ 924 KB)